Le soutien financier de projets de recherche prometteurs est une tâche importante de la Société suisse SEP. Elle contribue ainsi à gagner de nouvelles connaissances sur l’origine de la maladie ainsi que sur les thérapies et permet d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de SEP. Le contenu de cette page est en anglais ou dans la langue maternelle des chercheuses et chercheurs concerné-e-s (de/fr/it).
Projets soutenus
Aperçu des projets de recherche soutenus financièrement par la Société SEP jusqu’à présent.

Quels projets la Société SEP a-t-elle soutenus?
La période de financement de 2 ans de la Société suisse de la sclérose en plaques soutient des projets de recherche fondamentale, clinique et de réadaptation. Dans de courtes vidéos, les chercheurs et chercheuses soutenus expliquent leurs projets (dans leur langue maternelle).
Projets de recherche 2023/2024

Donatella De Feo, Universität Zürich
Progressive Multiple Sklerose: Rolle von Entzündung und Alterung bei der Schädigung des …

Giulio Disanto, Ospedale Regionale di Lugano
Measures of «smouldering MS» in natalizumab and ocrelizumab treated MS patients | Misure di …

Renaud Du Pasquier, Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV
A la recherche d'anticorps spécifiques du système nerveux central dans la SEP grâce à un sytème …

Daniela Latorre, ETH Zürich
Esplorando cellule T specifiche per antigeni lipidici in Sclerosi Multipla (Exploring …

Sarah Mundt, Universität Zürich
Krankheitverursachende und schützende Funktionen von Fresszellen im zentralen Nervensystem: Kann das …

Christian Münz, Universität Zürich
Die Rolle der Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV) bei der Auslösung noch nicht klinisch …

Julie Peron, Université de Genève
La personnalité comme prédicteur du handicap dans la sclérose en plaques: une étude de suivi …

Anne-Katrin Pröbstel, Universitätsspital Basel
EXPAND: Expansion anti-entzündlicher B-Zellen unter B-Zelldepletion (EXPAND: Expansion of …

Piotr Radojewski, Universitätsspital Bern
Gehirnalterung: eine vergleichende Studie von Gesunden und Menschen mit Multipler Sklerose (Brain …

Matthias Walter, Universitätsspital Basel
Non-invasive transcutaneous spinal cord stimulation spinal cord to improve lower urinary tract …

Projets de recherche 2023/2024
Chercheuses et chercheurs soutenus
Projets de recherche 2021/2022

Zina-Mary Manjaly, Schulthess Klinik Zürich
Mechanismen der Fatigue bei Multipler Sklerose: Untersuchungen mit funktionellem MRI In unserem …

Jens Bansi, Kliniken Valens
CYPRO – Die Effekte von Ausdauertraining bei Personen mit Primär Progredienter MS CYPRO setzt sich …

Benjamin Ineichen, Universitätsspital Zürich
Detaillierte Charakterisierung von MS-Schäden im Gehirn mittels künstlicher Intelligenz und …

Thorsten Buch, Universität Zürich
Manipulation der CARD9-vermittelten Signalübertragung zur Behandlung von MS Eine wachsende Anzahl …

Johanna Oechtering, Universitätsspital Basel
Eine IgM-Antikörper-Produktion im Nervenwasser ist assoziiert mit einer Rückenmarks-Manifestation …

Maximilian Pistor, Universitätsspital Bern
Der Einfluss des Geschlechts auf die Wirksamkeit der MS-Therapieklassen «Sphingosine-1 Phosphate …

Sarah Guimbal, Theodor Kocher Institut, Bern
Erforschung der Mechanismen der Dysfunktion der Blut-Hirn-Schranke bei MS Ein wichtiges Merkmal bei …

Olivier Lambercy, ETH Zürich
Améliorer l’évaluation de la fonction des membres supérieurs chez les personnes atteintes de SEP …
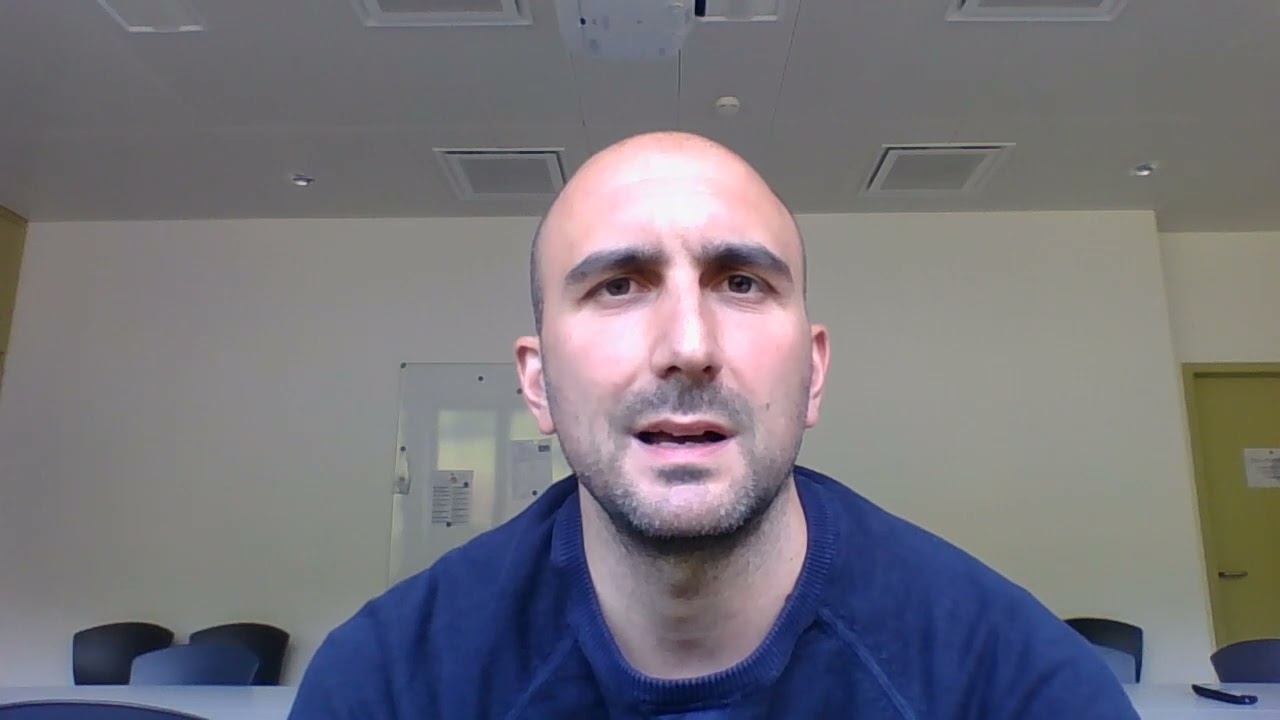
Giulio Disanto, Neurocentro della Svizzera Italiana, Lugano
Monitoraggio delle vaccinazioni per COVID-19 in persone affette da sclerosi multipla sotto diversi …

Christian Münz, Universität Zürich
Das Zusammenspiel genetischer und umweltbedingter Risikofaktoren bei der MS Die Autoimmunerkrankung …
Projets de recherche 2019/2020

Forschungsförderung 2019/2020
Interview mit Jürg Kesselring, Leiter Evaluationsgremium. Jürg Kesselring erläutert den …

Anke Salmen, Inselspital Bern Neurologie
Untersuchung von Autoimmunerkrankungen des Zentralen Nervensystems mit dem Fokus auf die Beteiligung …

Sandra Bigi, Inselspital Bern
Multiple Sklerose im Kindesalter besser verstehen und gezielter behandeln: Das schweizweite Register …

Sara Mundt, Universität Zürich Institut für Experimentelle Immunologie
Nervenzelluntergang bei der progressiven MS: Welche Rolle spielen lokale Fresszellen? Die Multiple …

Jan Kool, Rehaklinik Valens
Verbesserte Lebensqualität dank der kombinierten Behandlung von Ausdauer und Müdigkeit? Die …

Nicholas Sanderson, Universitätspital Basel
Warum haften Antikörper aus dem Nervenwasser an Nervenzellen? Antikörper sind Eiweisse, die von …

Britta Engelhardt, Theodor Kocher Institut Bern
Entwicklung von Stammzell abgeleitenten Blut-Hirn Schranken Modellen von Personen mit MS zur …

Robert Hoepner, Inselspital Bern Neurologie
Wirkt Vitamin D über den Glukokortikoidrezeptor? Die schubförmig remittierende Multiple Sklerose …

Annika Keller, Universitätsspital Zürich Neurologie
Vasculäre Synapsen und ihre Rolle in autoimmuner Neuroinflammation Das klinische Krankheitsbild von …